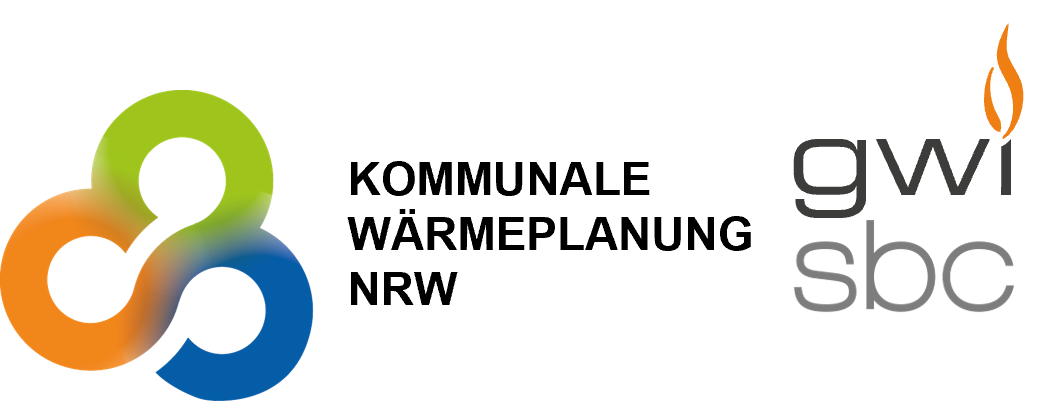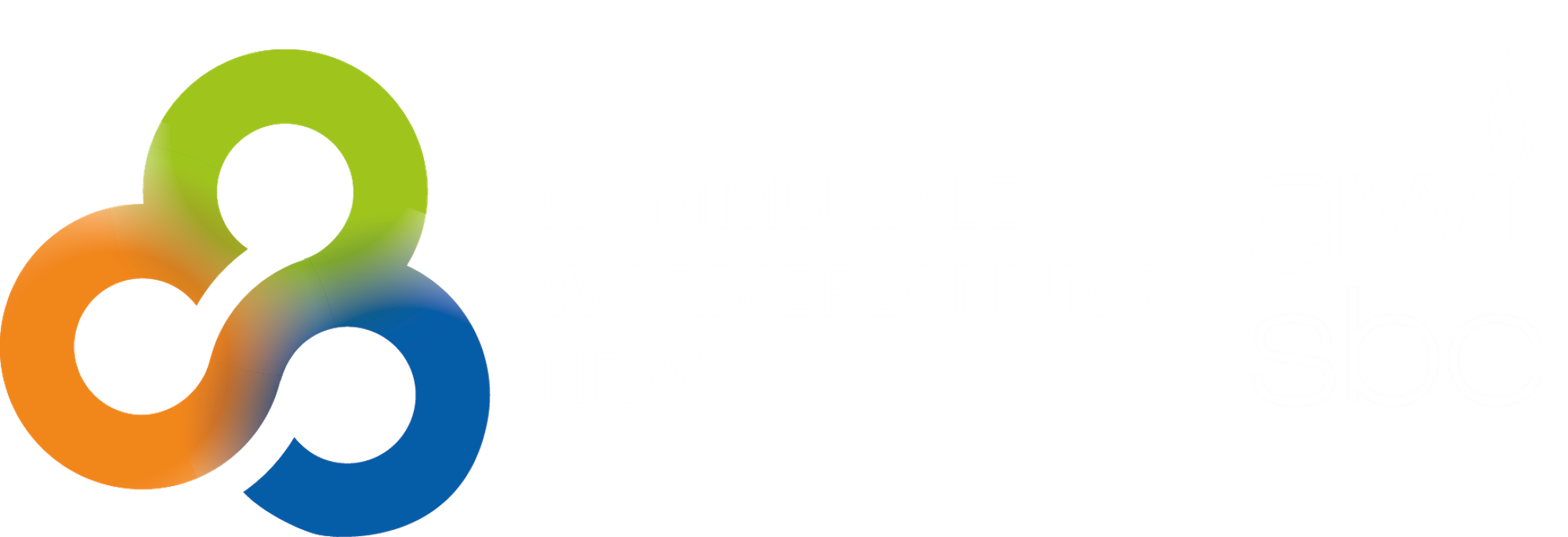WISSENSWERTES
1.
In der Bestandsanalyse werden die aktuellen Wärmebedarfe und die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen der Kommune ermittelt. Auch die lokale Energieinfrastruktur wird analysiert. Dabei werden wichtige Kennzahlen, wie die aktuellen Wärmeträger, die Nutzungsart von Gebieten und die Flächendichte, einbezogen.
2.
Ziel der anschließenden Potenzialanalyse ist die Identifikation und Bewertung der lokalen Potenziale für erneuerbare Wärmequellen und von Einsparpotenzialen. Hierbei werden zum Beispiel Flächen für Solar- und Geothermie oder industrielle Abwärmequellen bewertet und möglich Einsparungen im Wärmesektor durch die Gebäudesanierung berechnet.
3.
Auf Basis der erhobenen Daten und Erkenntnisse wird ein klimaneutrales Zielszenario für die Wärmeversorgung im Jahr 2045 entwickelt. Mögliche Entwicklungspfade werden auf die kommunalen Klimaziele und -strategien abgestimmt und in einer Szenarioanalyse verglichen.
4.
Zuletzt erfolgt die Strategiefestlegung. Als Ergebnis entsteht ein Maßnahmenkatalog, in dem konkrete Handlungsempfehlungen, Infrastrukturmaßnahmen und Projekte priorisiert und beschrieben sind.